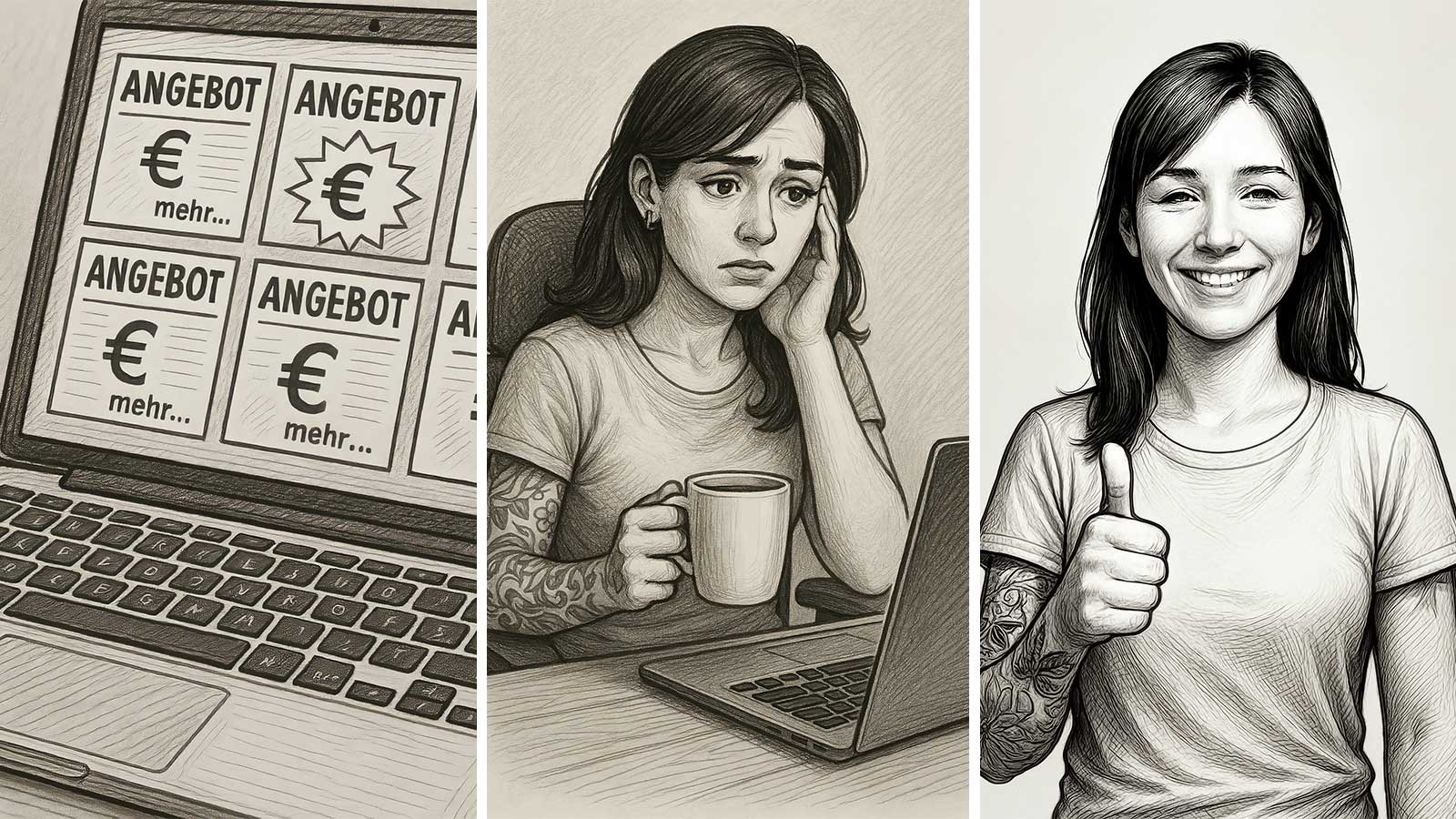Gemogelt?
Wenn die Verpackung nicht hält, was sie verspricht

Jede und jeder kennt das: Man freut sich auf einen gemütlichen Abend und reißt ein neues Sackerl Chips auf. Nach dem Öffnen stellt man mit Erschrecken fest, dass die Hälfte der Packung aus Luft besteht. Konsumentenschützer und Gerichte haben sich in der Vergangenheit bereits häufig mit „Mogelpackungen“ auseinandergesetzt.
Wesentlich ist: Sowohl der österreichische, der deutsche und auch der europäische Gesetzgeber einerseits sowie die Gerichte andererseits haben sich bereits eindringlich mit dem Thema des unlauteren Wettbewerbs bzw. der Irreführung auseinandergesetzt.
In Österreich findet sich die Rechtsgrundlage im Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG). Früher gab es im UWG sogar eine Norm, § 6a UWG, die jedoch im Zuge einer Gesetzesanpassung im allgemeinen Verbot von Irreführung, nämlich in § 2 UWG, aufgegangen ist. Zuletzt hat der Oberste Gerichtshof, das österreichische Höchstgericht für zivilrechtliche Angelegenheiten, im Jahr 2019 allgemein eine Mogelpackung wie folgt definiert: „Eine ‚Mogelpackung‘ ist eine Fertigverpackung, die durch ihre äußere Aufmachung über Anzahl, Maß, Volumen oder Gewicht der tatsächlich darin enthaltenen Waren irreführt. Maßgebend ist, ob ein angemessen gut unterrichteter und kritischer Durchschnittsverbraucher, der eine der Bedeutung der Ware angemessene Aufmerksamkeit an den Tag legt, einen Eindruck vom Packungsinhalt gewinnt, der nicht den Tatsachen entspricht und geeignet ist, ihn zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er sonst nicht getroffen hätte.“ (vgl. 4 Ob 150/18i).
Das bedeutet also, dass Verpackungen, deren tatsächlicher Inhalt ohne jegliche Rechtfertigung in keiner Weise dem äußeren Volumen entsprechen, als irreführend betrachtet werden können, wenn der Durchschnittsverbraucherin oder dem Durchschnittsverbraucher nicht auffällt, dass es eine offenkundige Überdimensionierung ist und sie bzw. er eben bewusst durch das Erscheinungsbild getäuscht wird. In der Praxis hat sich zuletzt oft gezeigt, dass auf den Verpackungen plötzlich ein gut sichtbarer Hinweis mit der tatsächlichen Füllmenge angebracht wird.
Was hat das mit dem Onlinevertrieb und der Werbebranche zu tun?
Nun, hierzu werfen wir einen kurzen Blick zu unseren liebsten Nachbarinnen und Nachbarn nach Deutschland. Der Bundesgerichtshof (BGH), also das deutsche Pendant zum Obersten Gerichtshof, hat sich im Jahr 2024 mit Mogelpackungen im Onlinevertrieb auseinandergesetzt. Dadurch, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich des unlauteren Wettbewerbs mit der österreichischen Rechtslage vergleichbar sind, können hier durchaus Parallelen gezogen werden.
Im konkreten Fall vor dem deutschen BGH hat ein Kosmetikkonzern in einem Onlineshop ein Duschgel in einer Tube mit einer Füllmenge von 100 ml angeboten. Es war dazu ein Produktbild im Onlineshop vorhanden. Die Tube war partiell transparent und teilweise undurchsichtig, wobei die Tube mit Duschgel tatsächlich nur im transparenten Bereich befüllt war! Im undurchsichtigen Teil befand sich kein Duschgel mehr, das war jedoch aus dem Produktbild nicht ersichtlich.
Das deutsche Pendant zum VKI (Verein für Konsumenteninformation) hat den Kosmetikkonzern wegen Irreführung geklagt. Sowohl das Erst- als auch das Berufungsgericht sind davon ausgegangen, dass wohl keine Irreführung vorliege und es bei einem Online-Kauf an der „Spürbarkeit“ eines Verstoßes hinsichtlich der Fertigpackung und des Vortäuschens fehlen würde. Der BGH hat das anders gesehen und gab dem Unterlassungsbegehren des „VKI“ Folge. Der BGH hat ausdrücklich ausgeführt, dass der Schutzzweck der Irreführung vom Vertriebsweg unabhängig ist und es daher sehr wohl wettbewerbsrechtlich relevant ist, wenn über die Produktpräsentation nicht die relative zur tatsächlichen Füllmenge durch die Verbraucherin oder den Verbraucher festgestellt werden kann. Im konkreten Fall war die Duschgeltube nur zu zwei Dritteln gefüllt, und das war eben von außen nicht erkennbar.
Mein Tipp
Als Werbeagentur können Sie Ihre Kundinnen und Kunden darüber informieren, dass diese bei ihren Produktpräsentationen allenfalls – so wie es mittlerweile auch auf Verpackungen erfolgt – darauf hinweisen, wie viel sich tatsächlich in der Verpackung befindet.