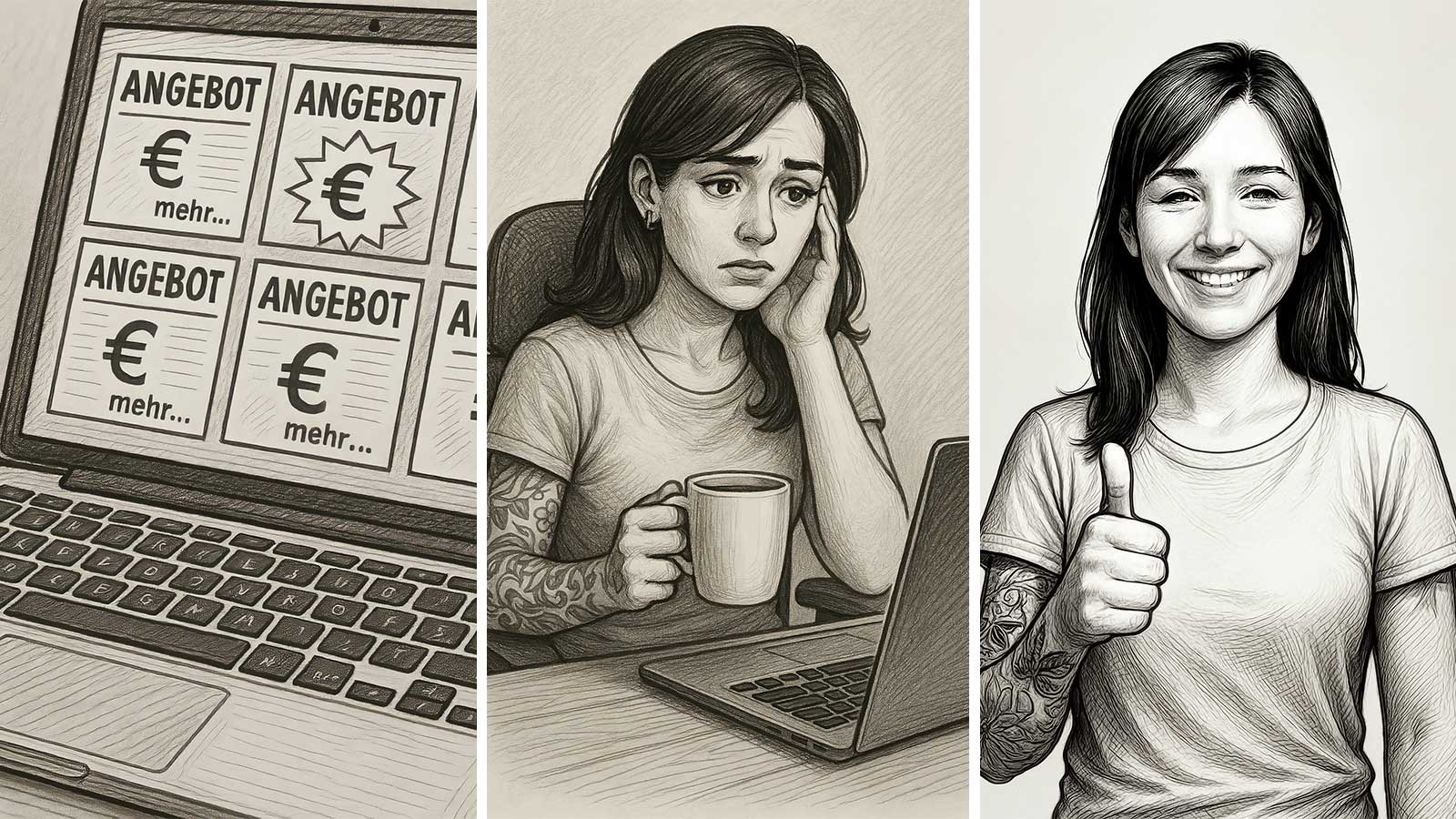Dark patterns?
Tricks im Onlinehandel
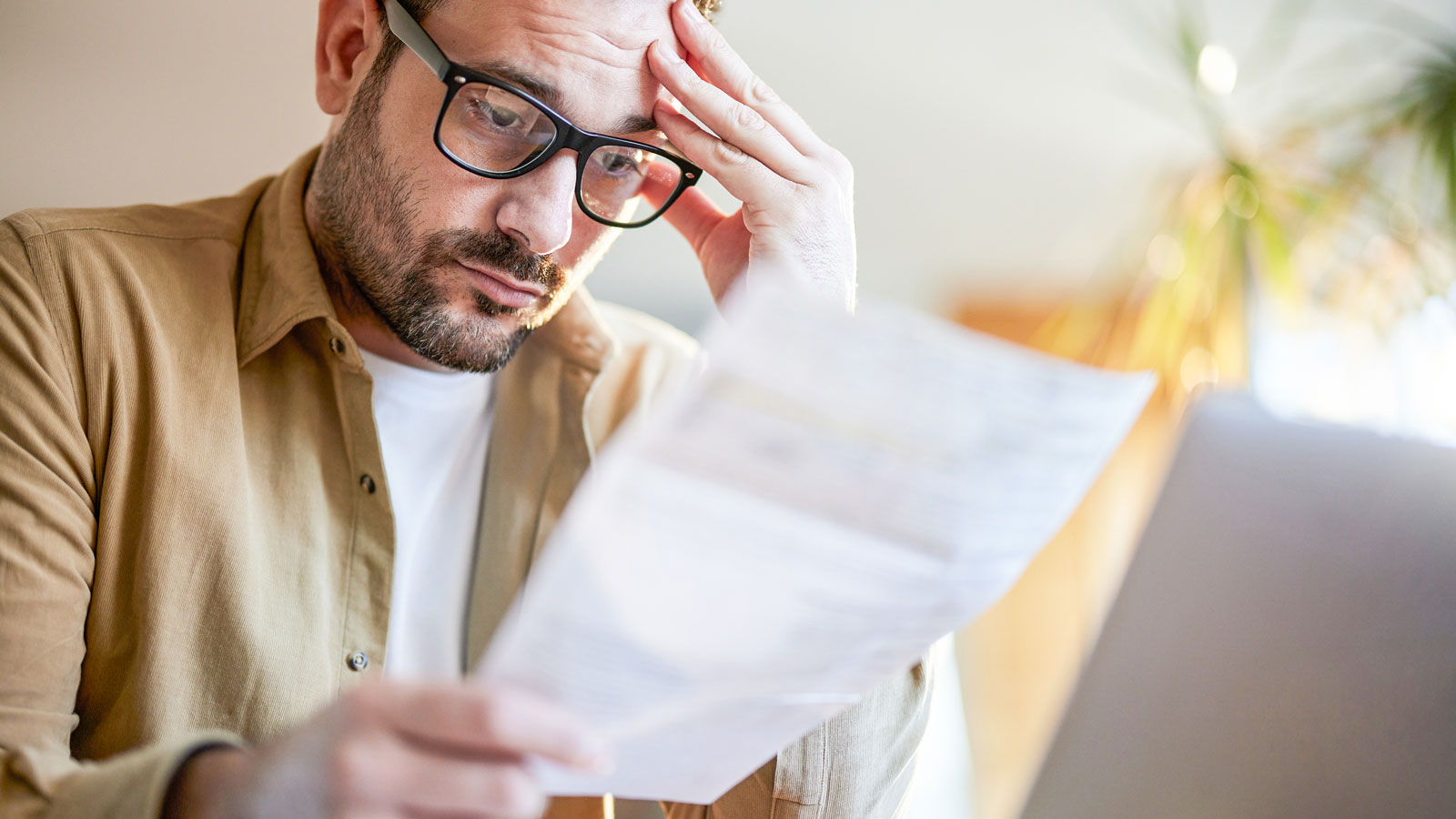
Klick! „Wir gratulieren Ihnen, Sie haben ein neues Abo abgeschlossen“ – und plötzlich ist es wieder einmal passiert: Eine kurze Unaufmerksamkeit, und man ist auf das geschickte Webdesign hereingefallen.
Die Onlineanbieterinnen und -anbieter werden immer kreativer und bedienen sich mittlerweile unzähliger, teils unfairer, technischer und psychologischer Tricks bei der Gestaltung der Websites, Apps und Gerätemenüs. Diese wird derart gewählt, dass die Nutzerinnen und Nutzer unbewusst zu Entscheidungen gedrängt werden.
Grundsätzlich ist gerade die schlaue Gestaltung die „DNA der Kreativität“ in der Werbebranche, um in der Nomenklatur des Goldenen Hahn (2024) zu bleiben. Wie es jedoch in jeder Branche ist: Aufgrund der überschießenden Herangehensweise von schwarzen Schafen erfolgt eine Regulierung und Sanktionierung.
Manipulative Designs drängen Nutzerinnen und Nutzer in Entscheidungen, die sie so vielleicht nicht treffen würden.
Schwierig: Abo kündigen?
Kurios ist, dass es mittlerweile exemplarisch oft schwieriger wird, ein Abo zu kündigen, als eines abzuschließen, oder ein Konto mitsamt Registrierung anzulegen, es wieder zu löschen oder die eigenen Daten wieder zu entfernen. Genau das ist oft deutlich mühsamer und bewusst so gewollt. Der durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vorgegebene Cookiebanner wird ebenso oft gerne verwirrend gestaltet. Der Button „Allen Cookies zustimmen“ ist knallig, der faktisch wesentliche Button „nur erforderliche Cookies“ geht unter. Genau diese Gestaltung hat System, beim Webdesign spielen Marketing und IT zusammen.
Diese Tricks und Manipulationsformen werden auszugsweise im Netz aktuell gerne eingesetzt:
- Der Warenkorbtrick: Bei der Auswahl eines Produktes wird teilweise ein Extraservice (ohne es aktiv auszuwählen) als Kuckucksei in den Warenkorb gelegt.
- Abo- und Registrierzwang: Der Nutzerin oder dem Nutzer wird ein Abo (insbesondere gerne Newsletter) oder eine Registrierung aufgezwängt, obgleich es für den eigentlichen Zweck gar nicht notwendig wäre.
- Versteckte Infos: Informationen werden „direkt vor der Nase“ versteckt. Wie vorher das Beispiel zum Cookiebanner wird die Nutzerin oder der Nutzer über Farbauswahlen (leuchtend oder blass) dazu bewegt, spontan nur die eine Option zu wählen.
- Versteckte Werbungen: Etwas nicht als Werbung Gekennzeichnetes wird verführerisch zum Anklicken gestaltet.
- Privatsphäre-Irrgarten: Gut bekannt von Meta – eine Vielzahl an Privacy-Einstellungen, das Ganze wurde nach dem Facebook-Gründer Zuckerberg „Privacy Zuckering“ getauft.
- Verschleierte Preise: Die Einblendung von weiteren Kosten und Extragebühren erfolgt erst ganz am Ende des Bestellvorgangs, sodass die Nutzerin oder der Nutzer bereits resigniert.
- Verhinderung von Preis- und Produktvergleich: Durch unvollständige oder atypische Beschreibungen oder Mengenangaben kann verhindert werden, dass Preise auf einfache Art verglichen werden können.
- Die überladene Website: Die Nutzerinnen und Nutzer werden mit einer Unmenge an Informationen und Optionen
konfrontiert, sodass sie exemplarisch durch das Userverhalten oder Eingaben mehr Daten preisgeben, als sie
ursprünglich wollten. Durch ablenkende Designelemente, die Auswahlmöglichkeit aus zu vielen verwirrenden
Optionen, überlange Texte etc. wird die Anwenderin oder der Anwender bewusst überfordert und lange auf
der Seite gebunden, statt eine Wahl zu treffen. - Störende Unterbrechungen: Durch das Aufpoppen von Popups wird man unterbrochen und statt dem „Wegklicken“
zu einer Handlung gedrängt. - Hervorhebungen: Mithilfe von Farben, Schriftgröße, Größe von Schaltflächen oder Positionierungen wird versucht, die Nutzerinnen und Nutzer auf eine falsche Fährte zu locken.
- Zeitdruck bzw. simulierte Knappheit: Durch einen herunterlaufenden Countdown oder Aktivitätsmeldungen („7
andere Personen schauen sich gerade das Produkt an“) und Knappheitshinweise („geringer Vorrat“, „nur mehr 2
auf Lager“) wird mit der Angst der Nutzerinnen und Nutzer gespielt, um sie zu einer Entscheidung zu drängen.
Der Gesetzgeber versucht freilich, die schwarzen Schafe auszusortieren und durch gesetzliche Bestimmungen die überbordende Manipulation einzugrenzen. Wie bereits in diversen anderen Artikeln angeführt, ist das Internet eben kein rechtsfreier Raum.
Relevante Bestimmungen für das Thema Dark Patterns
UWG: Der Dauerbrenner in der Kreativbranche: das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Obwohl der Begriff „Dark Patterns“ relativ neu ist, gibt es das Verbot der aggressiven und irreführenden Werbe- und Vertriebspraktiken im UWG schon lange. Freilich muss hier im Einzelfall eine gesonderte Prüfung, die schlussendlich ohnedies nur von den Gerichten durchgeführt werden kann, vorgenommen werden. Zudem ist es jeweils eine Einzelfallbetrachtung, ob etwas manipulativ ist. DSGVO: Wie zuvor angeführt, gibt es insbesondere für die Cookiebanner eine exaktere gesetzliche Bestimmung, jedoch war auch dies ein langer Weg: Nutzerinnen und Nutzer dürfen eine Seite faktisch erst dann nutzen, wenn sie vollständig informiert wurden und freiwillig der kommerziellen Datennutzung zugestimmt haben.
Das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum.
Digitalvorschriften: Die EU hat durch den „Digital Service Act“ (EU-Verordnung, also primäres Recht) Onlineplattformen unter anderem für Werbevorschriften diverse Grenzen gesetzt. Der Grundtenor ist jener, dass die Onlineplattformen ihre Schnittstellen nicht so gestalten dürfen, dass Userinnen und User „getäuscht, manipuliert oder anderweitig in ihrer Fähigkeit, freie und informierte Entscheidungen zu treffen, behindert werden“. Der Digital Service Act ist seit 17. Dezember 2024 in Kraft und es wird sich in weiterer Folge zeigen, wie sich die Judikatur entwickelt.
Grundsätzlich positiv für die Kreativbranche ist freilich, dass die Gestaltung nach wie vor so kreativ wie möglich sein soll – jedoch sollte im Hinterkopf behalten werden, dass die Userinnen und User nicht überfordert und in keiner Weise manipuliert werden sollten.